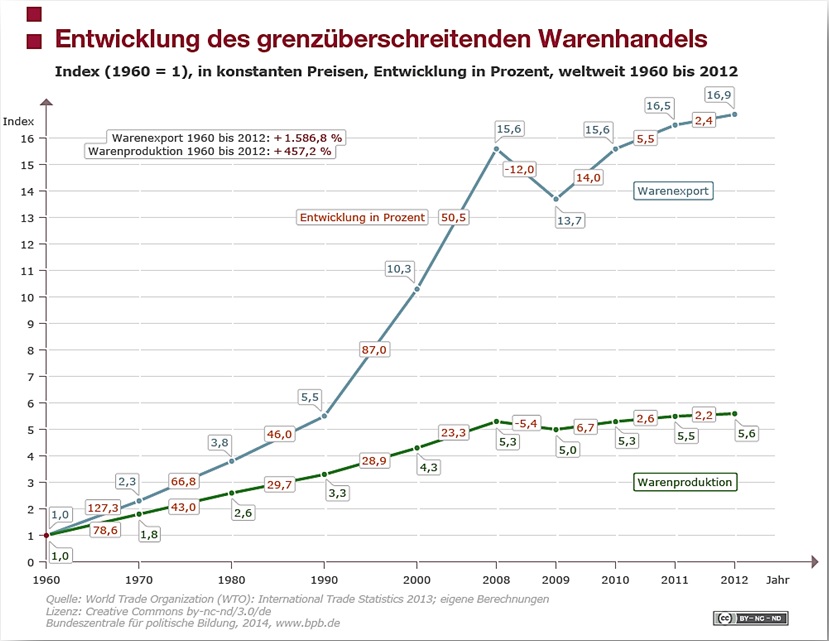Aktuell wird in den Medien und der Politik wieder verstärkt über “Freihandel” gesprochen. Den Anlass liefert u.a. die jüngste Verhandlungsrunde der Welthandelsorganisation (WTO) auf Bali und zum Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU (Transatlantic Trade and Investment Partnership: TTIP). Während die WTO mit dem Abschluss von Bali den “Kompromiss” von Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern feiert, ist die TTIP-Verhandlung anders gelagert. Hier sitzen Vertreter der Schwellen- und Entwicklungsländer nicht mit am Tisch und es geht auch nicht um die klassische Fragen, wie der Außenhandel auf Länder unterschiedlicher ökonomischer Ausgangslage wirkt und ob industriell rückständige Wirtschaften damit ihre Lage merklich verbessern und aufholen können. Über die TTIP soll sich insbesondere der ohnehin größte Wirtschaftsblock konsolidieren und verlorenes handels- und industriepolitisches Terrain gegenüber einigen Schwellenländern, allen voran China, zurückgewinnen. Dieses Ziel bestimmt die Debatten in den Industrieländern, um besser als bisher die Dynamik des Welthandels zur Stärkung der eigenen Exportindustrien zu nutzen.
Gleichzeitig wird ein mögliches Wirtschaftsabkommen zwischen der EU und den USA die Entwicklungsperspektive anderer Länder beeinflussen. Neue Standards und Regeln für den globalen Handel und die Produktion würden gesetzt, denen sich keine Volkswirtschaft dauerhaft entziehen kann. Dieser jüngste Versuch, die Gesetzgebung und Normsetzung über ein “Freihandelsabkommen” zu ändern, gibt Auskunft darüber, was “Freihandel” überhaupt bedeutet. Gemeint ist nie ein Handelsregime ohne umfangreiche, detaillierte Regeln. Weder gab es ein solches Regime in der Blütezeit der Freihandelsidee im 18. und 19. Jahrhundert, noch wird es den regellosen Handel künftig geben. Dafür werden allein die Unternehmen sorgen, die immer auf ein komplexes Regelsystem, Standards und Normen bestehen werden. Sonst lassen sich Eigentumsrechte gar nicht effektiv durchsetzen, Produktinnovationen und Produktionsverfahren nicht von Konkurrenten abgrenzen und Investitionen nicht sichern. Wie ein Zitronenfalter keine Zitronen faltet, beschreibt “Freihandel” nie den völlig freien Handel, sondern nur den Versuch, bis dato geltende Spielregeln zu verändern und anzupassen.
Die Freihandelsidee und deren Fehlinterpretation
Allein deshalb ist die öffentlich teils erhitzt diskutierte Frage, ob Freihandel gut oder schlecht ist, falsch gestellt. Bedient werden damit mediale Klischees und ein Reflex nach Vereinfachung. Aber es wird nichts darüber ausgesagt, zu welchem Zweck und mit welchen Effekten geltende Handelsregeln verändert und neue Regeln im Außenhandel etabliert werden. Nun steht die differenzierte Debatte ohnehin nicht hoch im Kurs. Die Segnungen eines “freien” Austauschs von Waren, Gütern, Dienstleistung und Kapital (Arbeit wird meist ausgeklammert) wird oft schlicht unterstellt. Im Bedarfsfall wird auf spezielle Thesen, theoretische Bausteine und empirische Untersuchungen verwiesen und öffentlicher Konsens hergestellt. Im Ergebnis steht jede differenzierte Wertung des Außenhandels unter dem Zwang sich zu rechtfertigen und Generalverdacht der Unwissenschaftlichkeit. Kritik an gängigen Meinungen gilt dann als reaktionär, bestenfalls als rückwärtsgewandt oder strukturkonservativ. Mit der Denunziation als protektionistisch und nationalistisch wird die Debatte vollends ideologisch aufgeladen.
Dabei gehören Handelsfragen seit jeher zum Kern aller theoretischen Debatten der Ökonomie. Vieles wird bis heute kontrovers diskutiert und bleibt ungeklärt. Auch war die Freihandelsidee noch nie unumstritten. Als dessen prominentester Kronzeuge gilt Adam Smith (1723-1790), der sich im Hauptwerk “Der Wohlstand der Nationen” von 1776 ausführlich zum Ex-/Import und deren Effekte für die Industrialisierung sowie Einkommens- und Verteilungsentwicklung äußerte. Konkret setzte sich der Engländer Smith kritisch mit dem Ansatz des französischen Merkantilismus auseinander und formulierte eine Position zum Freihandel, die sehr schnell zum Bezugspunkt für das sich formierende Bürgertum wurde. Deren Wortführer opponierten aus Eigeninteresse gegen Feudalstrukturen des Merkantilismus und nutzten Handelsfragen zur politischen Emanzipation. Neben dieser speziell machtpolitischen Wertung der Handelsfrage, wird auch übersehen, dass Smith nie von absoluten Vorzügen des Freihandels sprach. Für ihn hatte der Außenhandel sehr unterschiedliche Effekte für Klassen und Volkswirtschaften, und so argumentierte Smith im Kontext der Entstehung sowie Verwendung des Wohlstandes, der Entwicklung der Produktivkräfte und Arbeitsteilung der jungen industriellen Revolution.
Ähnlich differenziert äußert sich später auch David Ricardo (1772-1823). Er formuliert mit seinem Theorem der absoluten und komparativen Kostenvorteile in den “Grundsätzen der politischen Ökonomie und der Besteuerung” von 1817 die Basis der Außenhandelstheorie und gilt damit als Anwalt der absoluten Vorteilhaftigkeit des Freihandels. Aus unterschiedlichen Gründen ist diese Wertung aber ebenso falsch wie bei Adam Smith. Trotz Ricardos logischer Argumentation, die allen Studierenden der Ökonomie über das Beispiel des Handels von Tuch (Industrieware) und Wein (Agrarprodukt) zwischen England und dem weniger entwickelten Portugal bis heute nahegebracht wird, sind seine Thesen lediglich unter sehr spezifischen Bedingungen gültig. Ricardo weist etwa selbst darauf hin, dass es in seinen Argumentationen keinen oder sehr eingeschränkten Austausch von Kapital und Arbeit gibt. Genau diese harten Einschränkungen sind es dann auch, die den Außenhandel für weniger industriell entwickelte Wirtschaften vorteilhaft machen würden. Die klaren Restriktionen werden gern unterschlagen, was nicht überrascht. Denn sonst könnten sich die Wortführer der Freihandelsidee in Politik, Wissenschaft und im Feuilleton nicht so blumig auf Ricardo beziehen und den Außenhandel normativ als Segen für industriell rückständige Nationen anpreisen.
Industrielle Revolution und Außenhandel
Ricardos Einlassungen lassen sich ohne Bezug auf und Kenntnis der Situation in England nie richtig verstehen. Es tobte ein heftiger Streit zwischen den Befürwortern der Marktöffnung für Getreide aus Kontinentaleuropa und Vertretern scharfer Einfuhrgrenzen (corn law). Ricardo befürwortet die Marktöffnung und stellte sich gegen Feudalherren und Großgrundbesitzer, die um ihre Profite fürchteten. Diese Positionierung Ricardos war kein sozialpolitischer Akt oder dem Ruf nach “billigem Brot” geschuldet. Sinkende Getreidepreise waren für ihn zwingend, damit die Produktionskosten über alle Wirtschaftssektoren fielen und so die Profitabilität der Industrie steigen konnte. Sinkende Preise der Lohngüter (vor allem Agrarprodukte) waren für Ricardo und andere der einzig gangbare Weg und wenn dies nicht durch die Ertragssteigerung heimischer Boden möglich war, mussten die Lohngüter eben massiv importiert werden.
Die Hauptvertreter der ökonomischen Klassik hatten bei Handelsfragen stets die industrielle Dynamik im Blick. Unter damaligen Bedingungen des “stofflichen” Kapitalmangels (viel zu geringe Produktivität und niedriger Output in der Landwirtschaft und Industrie) waren die materiellen Grenzen der Akkumulation produktionstechnisch gesetzt. Der Außenhandel sollte dieses industrielle Grundproblem des relativ jungen Kapitalismus lösen helfen. Identisch war die Argumentation zum Außenhandel in den folgenden Debatten um die Industrialisierung der sozialistischen Länder und später dann der so genannten Entwicklungsländer. Ungeachtet politischer Fragen wurde das Problem des stofflichen Kapitalmangels im 19. Jahrhundert durch sinkende Löhne bei gleichzeitig fallenden Preisen der Lohngüter angegangen. Sonst wären die Erträge, Profite und Investitionen in der Industrie kaum so rapide erhöht und das Massenelend weiter auf die Spitze getrieben worden. Der Import preisgünstiger agrarischer Rohstoffe und industrieller Vorprodukte wird damit zur Basis der Industrialisierung und der Außenhandel findet hier seine zentrale Bestimmung.
Allerdings fabulierten Ricardo und andere nicht über den uneingeschränkten Freihandel. Der Ruf nach “Freihandel” für bestimmte Güter kannte ebenso harte zweckgebundene Grenzen für unzählige Güter und Produkte. Es ging darum, industriell hergestellte Waren aus England in die rückständigen Nationen unbeschränkt zu liefern und diese Nationen sollten Rohstoffe und Lohngüter nach England exportieren. Alle Waren, bei denen die englische Industrie (noch) keinen Wettbewerbsvorteil hatte, wurden gezielt und beschränkt importiert, um den internen Strukturwandel nicht zu gefährden. Die Hinwendung zum Außenhandel folgte damit klaren Etappen: Unter allen Umständen war erst im Inland eine industrielle Basis zu schaffen, die produktiv und stabil genug auf- und ausgebaut werden musste, um im zweiten Schritt gegen die ausländische Konkurrenz bestehen zu können.
Exemplarisch brachte Karl Marx (1818-1883) die wirtschaftlichen und ideologischen Gründe der Motive und Argumente in seiner Rede “Über die Frage des Freihandels” von 1849 auf den Punkt. Den Protagonisten ging es um die industrielle Revolution und den Aufstieg Englands zur führenden Industrienation. Welche Folgen der befürwortete selektive Freihandel für die arbeitende Bevölkerung in England und anderen Nationen hatte, war hier irrelevant, sekundär bzw. wurde mit schönen Worten kaschiert. Es findet sich bereits damals das heute gängige Argument, sinkende Preise der Lohngüter (heute aller Konsumgüter) wären nur von Vorteil für alle Arbeiter, denn sie könnten damit viel mehr konsumieren. Ausgeblendet wird hier der gesamtwirtschaftliche Zusammenhang: Sinkende relative/absolute Preise führen (i) stets zum Abbau von Arbeitsplätzen und Wandel der Wirtschaftsstrukturen (die von Joseph Schumpeter geprägte “schöpferische Zerstörung”), und (ii) sinkt eben auch der Preis der Ware Arbeitskraft (s.o.). Was also der “Verbraucher” gewinnt, verliert er/sie als “Beschäftigter”.
Diese und andere Aspekte der sozialen Folgen des Außenhandels interessierte die Vertreter der Klassik nicht. Ebenso wenig ging es um die Frage, unter welchen Bedingungen industriell rückständige Nationen am Handel teilnahmen und ob sie zur Industrienation werden konnten. Diese blinden Flecken erklären sich insbesondere aus dem nationalen Selbstverständnis der Diskutanten und dem Gegenstand: Es ging um den Aufstieg der Industrienationen. Industriell rückständige Nationen hätten sich auf die arbeitsintensive Produktion zu konzentrieren, alle Industrienationen auf die Herstellung, den Verkauf und Export kapitalintensiver Produkte. Am Ende wäre eine harmonische, internationale Arbeitsteilung möglich – so die Vorstellung.
Paradoxer Ratschlag: Tue was ich sage, nicht, was ich gemacht habe
Eine solche “harmonische” Idee war aus erwähnten Gründen nie handlungsleitend für die reale Wirtschafts- und Handelspolitik. Der verfolgte Ansatz der Industrialisierung hatte weder theoretisch noch praktisch die Funktion, Rückständigkeit und Abhängigkeit aller Nationen gleichermaßen zu überwinden. Es ging um die Situation in England. Im Anschluss um den industriellen Aufstieg der kontinentaleuropäischen Nationen (u.a. Frankreich, Deutschland, Italien) und nach der erfolgreichen Revolution wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika ähnlich diskutiert. Die simple Übertragung klassischer Thesen für die heutige Debatte zur Rolle des Außenhandels für die so genannten Entwicklungsländern nach 1945 ist schon aus diesen Gründen kaum sinnvoll.
Richtig bleibt zwar, dass das Kernproblem des “stofflichen Kapitalmangels” unter anderen Vorzeichen dort noch heute vorliegt (vgl. Schoeller 1976, 2000). Falsch bleibt aber die These, über eine rapide Integration in den Welthandel würde das produktionstechnische Problem beseitigen, der produktive wie industrielle Rückstand abgebaut und ein breites Wirtschafts- und Einkommenswachstum realisiert. Seit Mitte der 1970er Jahre ist diese Position zwar zunehmend populär geworden und bestimmt die politischen Debatten. Unzählige Medien und Experten aus den Industrienationen empfehlen diese “Strategie” täglich den Ländern des globalen Südens. Aktiv wird über die bi- und multilaterale Zusammenarbeit, unzählige Handels- und Investitionsabkommen sowie Stützungs- und Strukturanpassungsprogramme von Weltbank und IWF dies aktiv durchgesetzt. Der umfassende Erfolg in der Breite ist bis heute jedoch ausgeblieben.
Schon aus Gründen der Redlichkeit sollte sich zur Verteidigung dieser fehlerhaften Strategie niemand auf Klassiker wie Adam Smith und David Ricardo stützen. Zu deren Zeit wurde ein solches Ansinnen nach voraussetzungsloser Integration der Nationen über den Außenhandel und die unkonditionierte Marktöffnung sowie interne Liberalisierung eher bei ökonomischen Wirrköpfen laut. Zumindest kannte man noch den Unterschied zwischen Propaganda und den Bedürfnisse nach Auf- und Ausbau nationaler Produktionsstrukturen und Akkumulation.
Wer heute nur den Außenhandel und die Marktöffnung als “Strategie” anbietet, argumentiert geschichtsvergessen. Denn alle heutigen Industrienationen und erfolgreichen Schwellenländer haben nie diese Rezepte verfolgt (vgl. Steiner 1997; Chang 2012:92ff.). Ihre Politik widerlegt praktisch das Liberalisierungsmantra und die Hoffnung auf private Initiative und ominöse Marktkräfte. Heimische Märkte wurden (und werden) abgeschottet und Investitionen gelenkt. Der Kapitalzufluss/-abfluss war strikt geregelt. Die Landwirtschaft und junge Unternehmen wurden geschützt und subventioniert. Erst ab den 1980er Jahren haben die Schwellenländer ihre Märkte in Teilen und abgestuft geöffnet, was u.a. als ein Grund für die in schnellerer Folge auftretenden Wirtschafts- und Finanzkrisen gilt. Ungeachtet dessen war die Grundlage für diese Marktöffnung und stärkere Hinwendung zum Außenhandel die klare Protektion und der aktive Entwicklungsstaat. Sonst wäre die Produktivität in der Landwirtschaft und Industrie kaum hinreichend gestiegen, um agrarische Rohstoffe, industrielle Vorprodukte und Konsumgüter auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig anbieten und sich so relative wie absolute Marktanteile gegen die Industrienationen sichern zu können.
Leerstellen der ökonomischen Theorie
Sucht man nach Gründen für die Dogmatik der modernen Debatten zur Funktion und über die Effekte des Außenhandels für Entwicklungsländer ist eine Antwort, die vorgeschlagenen Rezepte würden die Vorherrschaft der Industrienationen weiter sichern. Deren Unternehmen, Konzerne und Finanzakteure profitieren massiv und überproportional von der Liberalisierung, Marktöffnung, veränderten Normen, Standards und Regulierungen.
Wenig überraschend sind deshalb auch die jüngsten Ergebnisse des “Globalisierungsreport 2014” der Bertelsmann Stiftung, die den banalen Sachverhalt mit obskurer Methodik eines “Globalisierungsindexes” aufwendig umschreibt. Banal, da die Voraussetzung des “Erfolgs” der historisch lange Aufbau einer immens produktiven industriellen Basis und Wertschöpfung ist. Genau diese Voraussetzung wird in solchen und ähnlichen Untersuchung gar nicht mehr hinterfragt und korrekt eingeordnet. An der Spitze stehen Unternehmen aus den Ländern, die bei Produktion, Innovation und Finanzierung auf dem Weltmarkt haushoch überlegen sind. Sie bestimmen die Richtung und die Verteilung der Gewinne und Verluste der Globalisierung. Die beachtliche Differenzierung internationaler Wertschöpfungsketten, die Auslagerung von Produktion und Konstruktion komplexer Unternehmensstrukturen und der Anstieg der Direktinvestitionen in dynamisch wachsenden Märkten hat daran nichts geändert.
Exemplarisch belegt die bisher vorliegende umfassendste Netzwerkanalyse von 30 Millionen Wirtschaftseinheiten die Existenz von 43.060 transnationalen Unternehmen. Über die Besitzverhältnisse lassen sich darüber 147 Unternehmen (0,3 Prozent) identifizieren, die ca. 40 Prozent aller transnationalen Konzerne kontrollieren. Schließlich ist bis heute rund 2/3 des Welthandels intra-industrieller Handel – also Handel zwischen den Unternehmen. Da diese nun zahlenmäßig am häufigsten in den Industrienationen angesiedelt bzw. über Tochterunternehmen verflochten sind, erklären sich die Grundstruktur des Welthandels und dessen interregional Zuschnitt.
Entsprechend wirkt das hinlänglich bekannte Problem von Zentrum und Peripherie bis heute weiter fort: Im Unterschied zu den Industrienationen und wenigen Schwellenländern sind die übrigen Volkswirtschaften bei Produktion und Handel global abgehängt – sie spielen schlicht keine signifikante Rolle. Primär sind sie auf den Verkauf mineralischer, fossiler Rohstoffe, Agrargüter (cash crops) angewiesen und bleiben abhängig von volatilen Preisentwicklungen, der kaufkräftigen Nachfrage industrieller Zentren und/oder sind deren verlängerte Werkbank. Korrupte Eliten in den Ländern können sich damit zwar relativ gut reproduzieren und einen hohen Konsum und Luxus leisten. Aber eine sinnvolle ökonomische Verwendung der über diesen fragilen, abhängigen Handel und die Produktion erzielten Überschüsse ist kaum zu beobachten. Entsprechend fehlt es an Investitionen in die Infrastruktur und generell an einer Politik, die dortige Industrien und Unternehmen fördert, durch effektive Protektion begleitet, darüber gezielt den Anteil der internen Wertschöpfung erhöht und die Produktivität massiv steigert. Selbst China ist trotz aller Erfolge davon entfernt, die Abhängigkeit vom Konjunkturverlauf in den Industrienationen hinter sich zu lassen. Der Sprung auf die nächste Ebene und die strukturelle Transformation von Ökonomie und Gesellschaft ist noch nicht gelungen und birgt weiterhin unzählige Schwierigkeiten (vgl. Pettis 2013).
Nun ist eine machtpolitische Antwort auf die Frage, warum sich die neoklassische/neoliberale Logik bei der Betrachtung des Außenhandels durchgesetzt hat, allein eher unbefriedigend. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die theoretischen Änderungen in der Wirtschaftswissenschaft. Während in der klassischen Ökonomie das Problem des “stofflichen Kapitalmangels” und damit die Bedingung für den Erfolg im Außenhandel zentral waren, rückt diese Betrachtung immer mehr an den Rand. Bereits die sich im späten 19. Jahrhundert etablierende Neoklassik hat einen andern analytischen Ansatz und Gegenstand im Blick, ähnlich ist es bei dem dazu im Kontrast formulierten Keynesianismus Beginn des 20. Jahrhunderts (vgl. Rostow 1990).
Die Neoklassik konzentrierte sich u.a. auf die gleichgewichtstheoretische Begründung von Preisen, Zinsen, Profiten, Löhnen und den Bedingungen der Markträumung. Es ging um die effiziente Allokation der Produktionsressourcen (Arbeit, Kapital und Boden) in einem so weit entwickelten Industriekapitalismus, der das Problem unzureichender absoluter Überschüsse hinter sich gelassen hatte. Es ging um die Erklärung funktionsfähiger Märkte, das rationale Verhalten von Marktindividuen, Unternehmen und Haushalten mit entsprechenden Geld- und Kapitalmärkten. Der Keynesianismus grenzte sich zwar vom orthodoxen Ansatz (Klassik und Neoklassik) ab, betrachtete aber den gleichen Gegenstand – den relativ entwickelten Industriekapitalismus. Ungleichgewichte, Konjunktur- und Wachstumsprozesse, die effektive Nachfrage, Verteilungsverhältnisse und die negativen Folgen und strukturellen Risiken der industriellen Geldwirtschaft standen deshalb im Zentrum (vgl. Christen 2013:381ff.).
Folglich wird in den Varianten der Neoklassik und des Keynesianismus erstens nicht danach gefragt, wie Wachstum und Entwicklung in einer vorindustriellen Gesellschaft entsteht und zweitens wird nicht direkt erklärt, wie Industrialisierung und Entwicklung überhaupt möglich wird. Beides wird bestenfalls indirekt behandelt. Neoklassische und (post)-keynesianische Ansätze lassen sich folglich zur Problemanalyse industriell rückständiger Ökonomien im 21. Jahrhundert nicht ohne weiteres einfach nutzen. Viele moderne Debattenbeiträge zur Rolle des Außenhandels für die nachholende Industrialisierung sind schon deswegen kaum hilfreich. Kapriziert wird sich in der Regel in theoretischen, empirischen Studien darauf, wie offen und geschlossen Volkswirtschaften sein müssten, um die positiven Effekte des Außenhandels und der Marktöffnung (bezogen auf entwickelte Industrienationen) auch hier zu realisieren.
Die Debatte zum Außenhandel bewegt sich so im Rahmen einer falschen Gegenüberstellung von “Freihandel oder Protektionismus”. Erklärt wird aber damit nie, wie bei den exorbitanten Unterschieden der industriellen, landwirtschaftlichen Produktivität die skizzierte strukturelle Abhängigkeit je verringert werden kann. Wie sollen Unternehmen aus industriell rückständige Wirtschaften in der Breite überhaupt gegen Unternehmen, Konzerne und Finanzakteure aus den Industrienationen “wettbewerbsfähig” werden und wie intern “Märkte” für Konsum-, und Agrarprodukte und Dienstleistungen entstehen? Und wie wird Entwicklung möglich in einem Umfeld, in dem die Industrienationen versuchen ihre binnenwirtschaftlichen Probleme durch neomerkantilistische Politik zu kompensieren? Angesichts dessen ist die ständige Aufforderung, setzt auf “Freihandel” und öffnet die Märkte nicht nur völlig geschichtsvergessen, praxisfern und theoretisch fragwürdig, sie ist geradezu zynisch.
Christian Christen ist Publizist und promovierter Volkswirt. Zuletzt von ihm in Wirtschaft und Gesellschaft – Analyse & Meinung erschienen: Demographischer Wandel und Generationengerechtigkeit – Seichte Modebegriffe mit knallharter Botschaft. Er unterhält auch eine eigene Internetseite: www.chefvolkswirt.net.
Literatur
Pettis, Michael (2013): The Great Rebalancing – Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy. Princeton/Oxford
Rostow, Walt W. (1990): Theorists of Economic Growth from David Hume to the Present. New York/Oxford
Steiner, Roald (1997): Investierbarer Überschuss und Außenhandel – Über interne und externe Bedingungen nachholender Entwicklungsprozesse. Marburg
Schoeller, Wolfgang (1976): Weltmarkt und Reproduktion des Kapitals. Frankfurt a.M.
Ders. (2000): Die offene Schere im Welthandel – Und wie sie zu schließen ist. Heilbronn
Dieser Text ist mir etwas wert
|
|